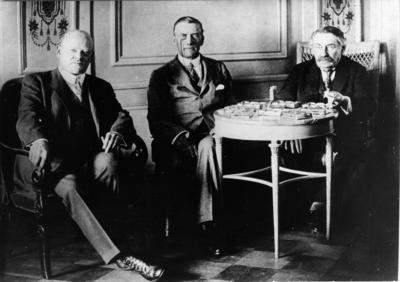Text
[Wirtschaftliche Lage der deutschen Industrie, Achtstundentag]
Geheimrat v. Borsig gab zunächst der großen Sorge Ausdruck, die die Arbeitgeberverbände bezüglich der Lage der Wirtschaft für die Zukunft erfülle. Die Belastung der Wirtschaft, insbesondere durch soziale Lasten, sei zur Zeit derart, daß von einer Verdienstmöglichkeit nicht mehr geredet werden könne. Viele Industriezweige hielten sich zur Zeit nur notdürftig über Wasser, und auf[129] die Dauer würde eine scharfe Krisis unvermeidbar sein. Beispielsweise betrage in seinem Werk in Tegel der Absatz etwa nur 1/5 des Friedens. Dabei müsse man in Betracht ziehen, daß das Werk Tegel 1913 eine Steuerlast von jährlich 104 000 M gegenüber 1 067 000 M im Jahre 1925 zu tragen hatte. Die sozialen Lasten seien in dem gleichen Zeitraum von 282 000 auf 563 000 M gestiegen, die sozialen Unkosten sogar von 80 000 auf 394 000 M. Unter solchen Umständen könne die Industrie nicht weiterarbeiten.
Dr. Eichberg (Linke-Hoffmann-Lauchhammer) sagte eine nahe Katastrophe der Wirtschaft voraus. Sehr viele Betriebe arbeiteten unter den wahren Selbstkosten. Dadurch sei die Unmöglichkeit gegeben, Kredite, die man habe aufnehmen müssen, zurückzuzahlen, und es bliebe nichts übrig als Betriebsniederlegungen. Zu allem Unglück seien noch neue Lohnbewegungen in Sicht; in Sachsen beispielsweise wollten die Arbeiter mit Gewalt den Achtstundentag durchsetzen. Zu berücksichtigen sei ferner, daß die Eisenbahnfrachten 70% höher seien als im Frieden. Er gebe zu, daß es schwer sei für die jetzige Regierung, hier Wandel zu schaffen, aber unter allen Umständen müsse der Lohnbewegung Halt geboten werden.
Dr. Haßlacher (Rhein. Stahlwerke) betonte, er habe schon früher die allgemeine Einführung des Achtstundentages bekämpft und müsse diese seine Stellungnahme nochmals betonen. Die Berücksichtigung der Wirtschaft sei höchste Politik. Die von ihm geleiteten Rheinischen Stahlwerke hätten Anfang 1924 eine Schuldenlast von 2 Millionen Mark gehabt, Ende 1924 habe sich diese Schuldenlast um 20 Millionen auf 22 Millionen M erhöht. Diesen 22 Millionen sei der Substanzverlust in Höhe von 13 Millionen Mark hinzuzurechnen, so daß ein Defizit von 35 Millionen Mark entstanden sei. Wo solle da für das Werk noch Kredit herkommen? Zum Glück kenne das Ausland nicht immer die traurige Lage der einzelnen Werke, sonst würden jetzt schon die Auslandskredite viel spärlicher fließen. Das sei das Bild des Jahres 1924. Im Januar 1925 sei die Lage noch viel schlimmer geworden. Dabei müsse man davon ausgehen, daß die Rheinischen Stahlwerke ein besonders günstiger Betrieb seien. Daraus ergebe sich, daß die Zahlen nicht mal als Durchschnittszahlen angesprochen werden könnten, daß vielmehr bei den meisten Werken die Situation eine noch viel schlimmere sei. Die Goldbilanzen sagten ja nichts über die Verluste. Man könnte die Verluste durch die Goldbilanzen „verschleiern“, aber im Juli bzw. am Schluß des Jahres 1925 würde die Gefährlichkeit der Lage sich ohne weiteres bilanzmäßig ausweisen. Nun käme dazu, daß der Achtstundentag ab 1. März 1925 gelten solle3. Das bedeute für die Eisenindustrie eine Mehrbelastung der Tonne Eisen mit 1,60–2,00 M. Mit der Forderung nach dem Achtstundentag seien aber die Ansprüche der Arbeiter keineswegs zu Ende. Alle Hüttenarbeiter, also auch die Tagarbeiter, forderten jetzt 8 Stunden Arbeit und die Bergarbeiterschaft sogar nur noch 7 Stunden Arbeit. Ferner sei dieser Tage ein neues Lohnabkommen zustande gekommen, wonach der Stundenlohn um 4 Pfennig erhöht würde.[130] Das sehe nicht nach viel aus, mache aber für die Rheinischen Stahlwerke allein eine monatliche Mehrausgabe von 100 000 M aus. Diese Erhöhung der Herstellungskosten machten einen Export unmöglich. Schon jetzt sinke die Ausfuhr ständig und in starkem Maße. Die Folge sei, daß viel weniger Devisen hereinkämen. Unter diesen Umständen könne man einen sicheren Zusammenbruch voraussehen. Dem Reichsarbeitsminister seien seinerzeit alle diese Gründe vorgetragen worden, er habe erklärt, die Frage des Achtstundentages sei eine politische, und er hätte sich bereits in der Frage festgelegt4. Eine Besserung der Konjunktur sei unwahrscheinlich. Die Industrie könne auch die Preise nicht erhöhen. Sie seien an sich gering, beispielsweise seien die Eisenpreise nur um 15% höher als im Frieden. Zur Hebung der Absatzmöglichkeit bliebe nur übrig, die Selbstkosten zu verringern und ebenso von einer Heraufsetzung der Löhne und sozialen Lasten abzusehen. Um ein Beispiel anzuführen, sei die Kommunalbelastung in Duisburg pro Tonne Eisen von 21 Pfg. im Frieden auf zur Zeit 3 M gestiegen. Er wolle nur noch bemerken, daß die Produktion 30% höher sei als im Frieden. Zum Schluß bäte er, die von ihm gemachten Angaben, insbesondere die Ausführungen über die finanzielle Lage der Rheinischen Stahlwerke vertraulich zu behandeln.
Herr Blohm (Blohm & Voß Hamburg) führte aus, daß nur eine erhöhte Sparsamkeit zum Ziele führe. Die Umsatzsteuer sei im Etat beispielsweise im Monatsdurchschnitt mit 120 Millionen angesetzt gewesen, sie habe aber im Januar nicht weniger als 216 Millionen Mark gebracht. Die Länder und Gemeinden hätten den ihnen überwiesenen Teil der Steuern verausgabt, so daß sie auf neue Überweisungen nicht zu verzichten geneigt seien. Dabei dächten die Gemeinden z. B. auch nicht an einen Abbau der übernommenen Aufgaben. Er gäbe zu, daß die Parteien wohl kaum sich dazu hergeben würden, die Regierung in dieser Beziehung zu unterstützen. Es sei bekannt, daß gewisse Städte im Westen vierfachen Bestand ihres Beamtenpersonals gegenüber dem Frieden zur Zeit hätten. Eine Gemeinde beispielsweise habe einen Schlachthofdirektor, einen Wasserwerkdirektor, einen Gaswerkdirektor, obwohl weder ein Schlachthaus, ein Wasserwerk noch ein Gaswerk im Orte beständen5. Das ständige Arbeiten[131] mit dem Index halte er für gefährlich. In der Inflation sei diese Übung berechtigt gewesen, jetzt sei sie verfehlt. Eine Herannäherung der Beamtengehälter an die Friedensbezüge müsse genügen, und man dürfe auch hier nicht über das Ziel hinausschießen. Der Arbeitsnachweis in Hamburg, der früher Arbeitgebersache gewesen sei, sei jetzt verstaatlicht und koste 2½mal mehr als im Frieden. In Hamburg hätte ein Grundstückseigentümer für den Neubau eines Hauses, das 165 000 M gekostet hätte, einen Zuschuß von 215 000 M bekommen, und das sei nicht der einzige Fall. Die Folge sei Preistreiberei auf dem Baumarkt.
- 5
Eine umfangreiche Zusammenstellung von Beispielen ähnlicher Art übersendet der Reichsverband der Dt. Industrie am 8.7.25 im Rahmen einer Denkschrift über die Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Verbände. Es heißt darin u. a.: „Die Wurzeln unserer Ausgabenhypertrophie und Verwaltungsüberorganisation liegen in der Überspannung der öffentlichen Aufgaben und der Zersplitterung der Reichsverwaltung in lauter Sonderorganisationen, sowie in dem Neben- und Gegeneinanderarbeiten (Doppelarbeit) von Reichs- und Landesbehörden und in der weitgehenden Trennung von Gesetzgebung und Verwaltung unter verschiedene Träger. Vor allem haben wir zweifellos viel zu viel Beamte, die zu einem wesentlichen Teil damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu regieren und eine Menge unproduktiven Schreibwerks zu bewältigen. Also: Abbau der Gesetzgebung und Abbau der Aufgaben auf das unbedingt nötige Maß, Vereinfachung der Verwaltungsapparate, insbesondere hinsichtlich des Aufbaues der Behörden und der Zahl und Einstufung der Beamten im Wege der organisatorisch zweckmäßigsten Verteilung der verbleibenden Aufgaben.“ Es müsse alles darangesetzt werden, den Verwaltungsaufwand auf den Umfang der Vorkriegszeit zurückzuführen (R 43 I
/2358
, Bl. 347-356).
Der Reichskanzler bemerkte, daß der Reichsminister der Finanzen heute mittag diese speziellen Hamburger Fragen mit dem Staatsrat Lippmann besprechen werde6. Im übrigen wolle er bemerken, daß man vor allem darangehen müsse, die Länder auf die Unhaltbarkeit dieser Zustände hinzuweisen und auf Abhilfe zu drängen. Der Finanzausgleich, der jetzt geplant sei, werde in dieser Hinsicht erfolgreich wirken, da die Gemeinden und Länder gezwungen würden, bei verschwenderischer Haushaltsführung hohe eigene Zuschläge zu beschließen7.
Der Reichsminister der Finanzen bat die Herren um Unterstützung bei der Verlängerung des Besoldungs-Sperrgesetzes8. Hier müsse sich die Wirtschaft rühren. Auch müsse von seiten der Wirtschaft auf den Reichstag ein Druck ausgeübt werden.
- 8
S. den „Entwurf einer vierten Änderung des Besoldungssperrgesetzes“, den der RFM am 10. 3. dem RT zuleitet (RT-Drucks. Nr. 665, Bd. 399
). Zur Problematik des am 24.3.25 verkündeten Gesetzes (RGBl. I, S. 30
) s. die Denkschrift des RFM über das Besoldungssperrgesetz vom 14.1.25 (RT-Drucks. Nr. 412, Bd. 398
).
Geheimrat Bücher betonte, daß man nach den Darlegungen der Vorredner von einer Rentabilität der Wirtschaft nicht sprechen könne. Eine Besserung könne man aber nur erzielen, wenn man programmatisch vorgehe. Die Wirtschaft könne nur weiterleben, wenn sie die nötigen Kredite erhalte. Die Reichsbank sei wohl in der Lage, die Mark zu halten, aber nur mit ihrer Diskontpolitik. Der innere Wert der Mark sei ständig im Abnehmen. Das vorige Jahr habe eine Passivität der Handelsbilanz von 2¾ Milliarden ergeben. Der Rohstoffverlust Deutschlands müsse durch mehr Export ausgeglichen werden. Zu diesem Zwecke müsse man einen Export haben von etwa 150% des Jahres 1913, in Wirklichkeit betrage der Export nur 80,2% von 1913. Der Reichsverband der Deutschen Industrie sei bereit, an einem größeren Programm mitzuarbeiten. Kein Volk könne ohne staatliche Autorität, ohne Arbeit und Fleiß auf die Dauer leben, und es sei eine Unmöglichkeit, auf 33 Milliarden Produktion eine Last von 11 Milliarden Mark zu legen.
Dr. Vögler führte aus, daß man in jeder Weise einer Erneuerung von Werten begünstigen müsse. Man müsse vor allem die Einfuhr verringern. Früher habe ein Arbeiter jährlich 1480 M Unkosten verursacht, jetzt dagegen 2600 M jährlich.
[132] Der Herr Reichskanzler bat Herrn Vögler, der Reichskanzlei genaue Zahlen darüber zur Verfügung zu stellen9.
- 9
Nach Anmahnung durch die Rkei übersendet Vögler dieses Zahlenmaterial erst am 30. 5. Danach stellt sich der Unkostenvergleich 1925 : 1913 wesentlich günstiger als nach den obigen Angaben Vöglers dar, nämlich durch einen Unkostenaufwand (Lohn + soziale Lasten) für 1925 von 2529 und für 1913 von 1614 Mark (R 43 I
/1135
, Bl. 173 f.).
Dr. Vögler sagte dies zu und fuhr fort, daß das Reichsarbeitsministerium jetzt vor allem die Verantwortung trage. Die Lasten seien derart gestiegen, daß das Defizit der Handelsbilanz im Januar allein 600 Millionen betrage. Die meisten Werke seien zu 50–60% verschuldet, und die Schulden stiegen weiter. Die Lage sei so katastrophal wie noch nie. Es sei die große Frage, wie man die Produktion erhöhen könne, ohne gleichzeitig die Ausgaben zu vermehren.
Generaldirektor Dr. Eichberg erklärte, daß die Exportfähigkeit ihre Grenze finde in der Konkurrenzmöglichkeit. Man müsse vor allem versuchen, den inneren Wert der Mark zu heben. Der Reichsbankpräsident könne nur ihren äußeren Wert künstlich halten.
Geheimrat v. Borsig: Die 4 Pfg. Stundenlohnerhöhung, die der Schlichter des Reichsarbeitsministeriums vor kurzem bewilligt habe, bedeute für die deutsche Wirtschaft eine Mehrbelastung von etwa 2 Milliarden. Gewiß, an dieser katastrophalen Lage hätten auch die Arbeitgeber eine gewisse Schuld, aber vor allem läge der Fehler bei den Schlichtern, die glaubten, Beträge bewilligen zu müssen, die man im Frieden für ganz unmöglich gehalten hätte.
Der Reichskanzler erwiderte, daß leider die wenigen Industrien, denen es gut gehe, oder die eine Scheinblüte erlebten, in rücksichtsloser Weise ihre Löhne erhöhten und dadurch die anderen Industrien zwängen, ihnen zu folgen. Dadurch entständen fortgesetzt neue Lohnwellen. Das Amt der Schiedsrichter sei ein besonders schweres und undankbares. Man habe das beispielsweise gesehen an Herrn Mehlig, der seine Tätigkeit als Schiedsrichter mit dem Verlust einflußreicher Stellungen habe bezahlen müssen10. Er sagte den Herren Prüfung ihrer Wünsche zu und schloß sodann die Sitzung11.
- 10
Es handelt sich wohl um den früheren „Reichs- und Staatskommissar für gewerbliche Fragen für die Provinz Westfalen und den unbesetzten Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf“, Mehlich, der seit 1924 das Amt des „Ständigen Schlichters“ der Provinz Westfalen innehat (s. Handbuch für das Dt. Reich 1924, S. 162 und 1926, S. 183).
- 11
Über diese Prüfung in den Akten nichts ermittelt.
[…]